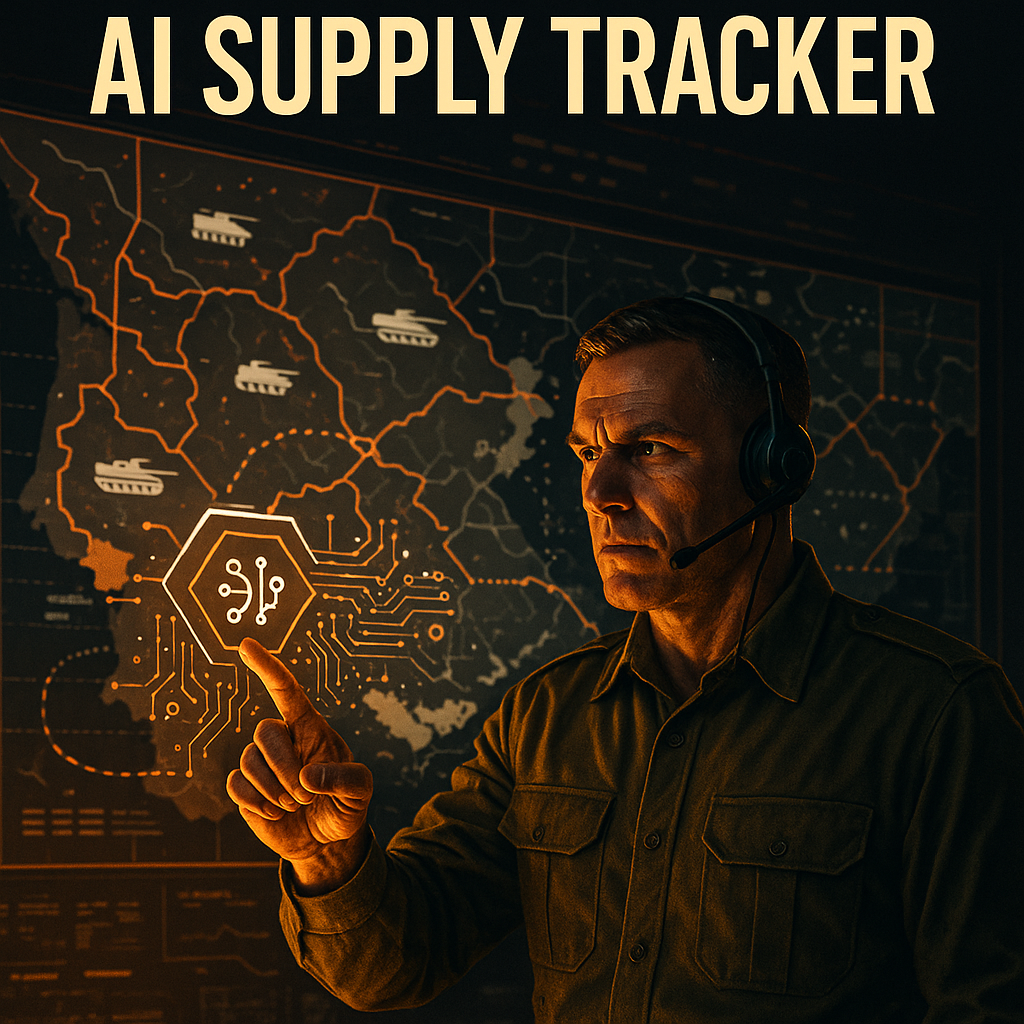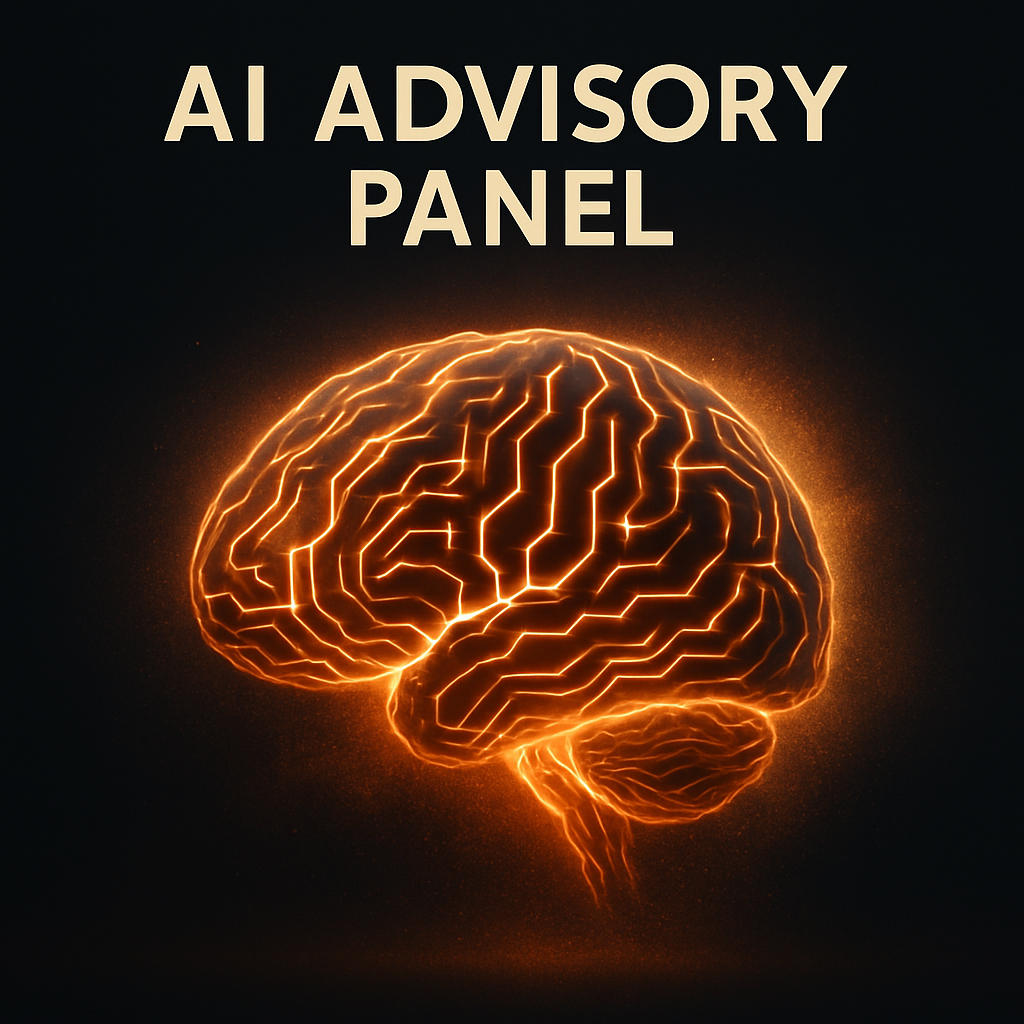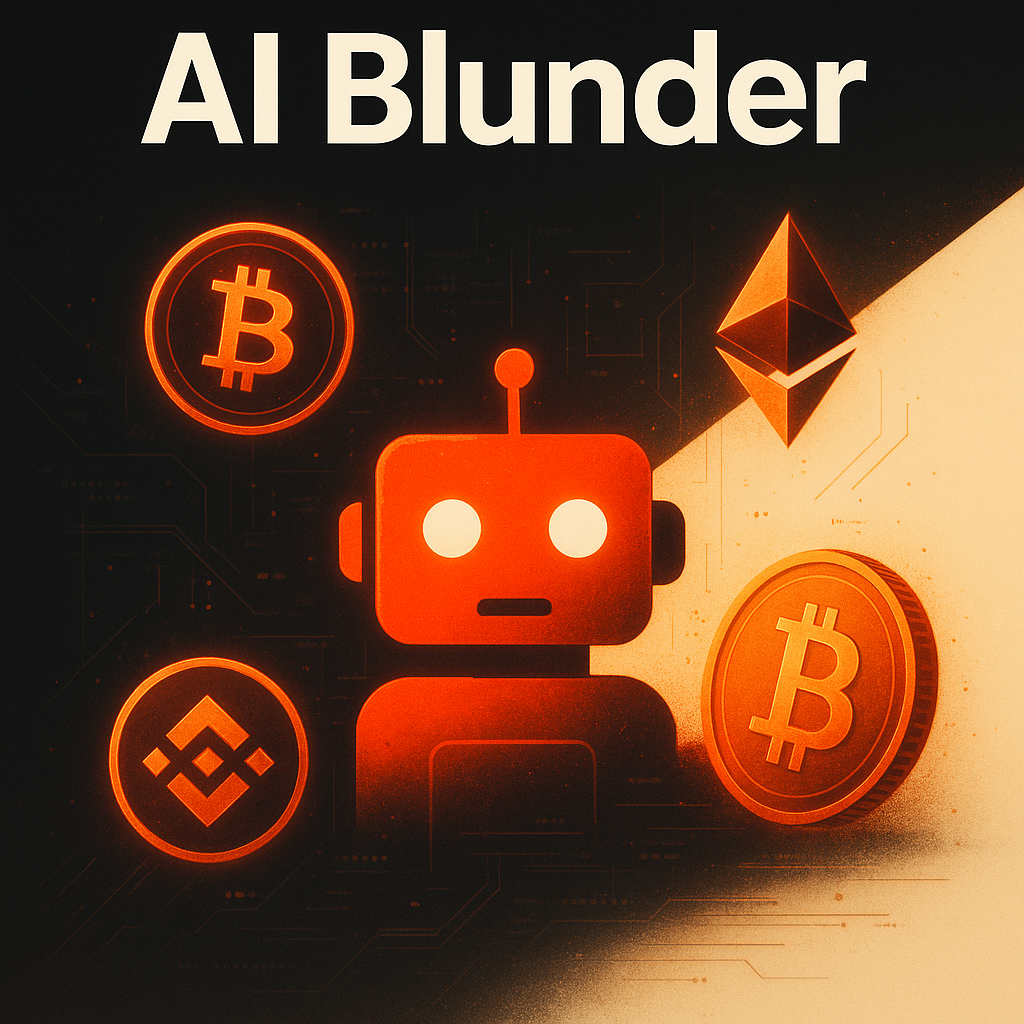A ProSocial AI Index: Warum wir KI neu messen müssen — für Menschen und Planet
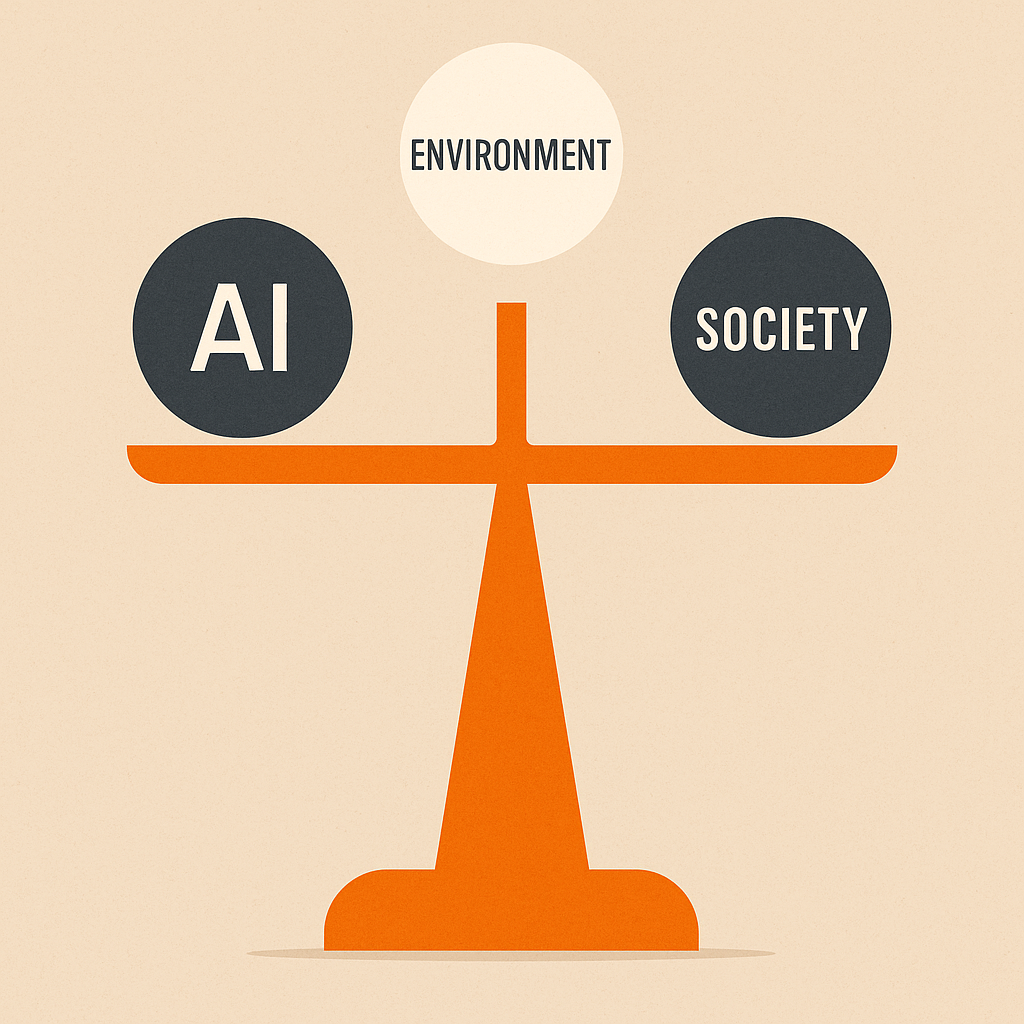
Warum die bisherige KI‑Messung nicht reicht
Wir messen KI vor allem mit technischen Kennzahlen: Genauigkeit, Latenz, Durchsatz. Diese Werte sind wichtig — aber sie sagen nichts darüber aus, ob eine KI Menschenrechte schützt, Ungleichheiten verringert oder den Planeten schont. Das Problem hat einen Namen: die "Measurement Trap" — wir optimieren das, was wir messen, und vergessen das, was eigentlich zählt. So können leistungsfähige Systeme entstehen, die kurzfristig glänzen, aber langfristig Schaden anrichten (z. B. durch verzerrte Entscheidungen, Verlust von Handlungsfähigkeit oder versteckte Umweltschäden).
Die Kernidee: ProSocial AI statt nur Safe or Compliant
ProSocial AI bedeutet: KI so entwerfen, trainieren und einsetzen, dass sie explizit dem Wohl von Menschen und Umwelt dient — nicht nur Mindeststandards erfüllt. Es geht darum, positive Wirkungen messbar zu machen, statt ausschließlich Risiken zu minimieren. Solch ein Ansatz ist gleichzeitig praktisch und moralisch: Wir wollen Technologien, die das Gemeinwohl fördern und sich an universellen Werten orientieren.
Das 4T‑Modell: Tailored, Trained, Tested, Targeted — verständlich erklärt
Die Autorin schlägt vier Prüfsäulen vor, die zusammen eine ganzheitliche Bewertung ermöglichen: - Tailored (maßgeschneidert): Wird die KI an lokale Kontexte und unterschiedliche Nutzergruppen angepasst? Beispiel: Eine landwirtschaftliche KI, die nur für industrielle Großbetriebe optimiert ist, hilft Kleinbauern kaum. - Trained (trainiert): Wie divers und repräsentativ sind die Trainingsdaten? Werden marginalisierte Perspektiven berücksichtigt? - Tested (getestet): Wurde die KI nicht nur technisch, sondern auch sozial und ökologisch getestet? Gibt es Studien zu Langzeitfolgen und unbeabsichtigten Effekten? - Targeted (gezielt): Hat die Lösung klare, messbare positive Ziele — etwa mehr Zugänglichkeit, weniger CO2‑Fußabdruck oder verbesserte Gesundheitsgerechtigkeit — und Mechanismen zur Anpassung? Diese vier T's bilden die Basis für einen ProSocial AI Index und helfen, konkrete Mängel aufzudecken.
Werte als Kompass: Die Goldene Regel in der KI‑Gestaltung
Ein besonderer Vorschlag ist, ethische Leitprinzipien wie die Goldene Regel („Behandle andere so, wie du behandelt werden willst“) in Messmetriken zu verankern. Praktisch heißt das: KI‑Entscheidungen sollten Stakeholder‑Wohlergehen berücksichtigen, nicht nur wirtschaftliche Interessen. Das ist weniger idealistisches Wunschdenken und mehr ein pragmatischer Weg, Systeme so zu designen, dass sie universell verträglicher werden — etwa indem Utility‑Funktionen oder Bewertungsmetriken menschliche Würde und Gerechtigkeit stärker gewichten.
Konkrete Messgrößen: Wie ein ProSocial AI Index aussehen kann
Ein Index müsste für jede 4T‑Kategorie messbare Indikatoren liefern: - Tailored: Beteiligung lokaler Gruppen im Design, Barrierefreiheit, sprachliche Anpassungen. - Trained: Anteil diverser Quellen, Offenlegung der Datenherkunft, Bias‑Audits. - Tested: Studien zur sozialen Wirkung, Ökobilanz, Berichte zu unbeabsichtigten Folgen. - Targeted: Klar definierte prosociale Ziele, KPI zur Messung positiver Outcomes, Anpassungs‑ und Rechenschaftsmechanismen. Solche Indikatoren könnten von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen genutzt werden — als Orientierung, Steuerungsinstrument und Rechenschaftsrahmen. Initiativen wie die Schweizer "AI for public good"‑Projekte oder bestehende Safety‑Indizes bilden bereits nützliche Bausteine, reichen aber nicht aus: ein Prosocial‑Index geht über Compliance hinaus und misst positiven Nutzen.
Beispiele: Landwirtschaft und Gesundheitswesen als Prüfsteine
Zwei anschauliche Fälle zeigen, wie anders die Bewertung aussieht, wenn man prosocial misst: - Landwirtschaft: Statt nur Ertragssteigerung zu messen, prüft der Index auch Bodenqualität, Wasserverbrauch, Biodiversität und die Autonomie der Landwirtinnen und Landwirte. - Gesundheit: Neben Diagnosegenauigkeit wird bewertet, wie die KI die Patient‑Arzt‑Beziehung beeinflusst, ob sie Zugang für benachteiligte Gruppen verbessert und ob sie gesundheitliche Ungleichheiten vermindert. Solche Mehrdimensionalität verhindert, dass ein kurzfristiger Gewinn langfristig schadet.
So wird der Index praktisch einsetzbar (für Sie, Unternehmen, Staaten)
Der Index soll kein Expertenwerkzeug bleiben. Vorschläge für die Anwendung: - Für Individuen: einfache Checklisten und Ampelbewertungen, um Apps oder Dienste einzuordnen. - Für Organisationen: Integrations‑Frameworks, die in Produktentwicklung und Governance eingebettet werden können. - Für Behörden: Richtlinien und Förderinstrumente, die nicht nur Risiken reduzieren, sondern positive Ziele incentivieren. Wichtig ist Transparenz: wer bewertet, mit welchen Daten und welche Folgen Bewertungen haben (z. B. Förderungen, Zertifikate, Marktzugang).
Praktische Checkliste: 8 Fragen, die Sie jetzt stellen sollten
Sie müssen kein Technikexperte sein, um KI kritisch zu prüfen. Acht einfache Fragen: 1) Für wen wurde die KI entwickelt? (Tailored) 2) Wurden Betroffene in den Entwicklungsprozess einbezogen? (Tailored) 3) Aus welchen Daten stammt das Training? Sind sie repräsentativ? (Trained) 4) Gibt es Bias‑Audits oder Transparenzberichte? (Trained) 5) Wurde die soziale und ökologische Wirkung getestet? (Tested) 6) Welche unbeabsichtigten Folgen wurden identifiziert? (Tested) 7) Welche positiven Ziele verfolgt das System? Sind sie messbar? (Targeted) 8) Gibt es Mechanismen zur Anpassung und Verantwortung? (Targeted) Beginnen Sie damit, diese Fragen zu stellen — sie schärfen den Blick und setzen Veränderungsdruck in Gang.
KI ist kein Schicksal — sie ist ein Gestaltungsfeld. Teilen Sie diesen Beitrag, diskutieren Sie die Checkliste in Ihrem Umfeld und fordern Sie bei Produkten und Politikern konkrete Antworten: Wie messen Sie, ob KI Menschen und Planet nützt? Wenn Sie möchten, erstelle ich eine druckbare Version der 4T‑Checkliste zum Ausdrucken oder ein kurzes Bewertungs‑Template für ein konkretes System.