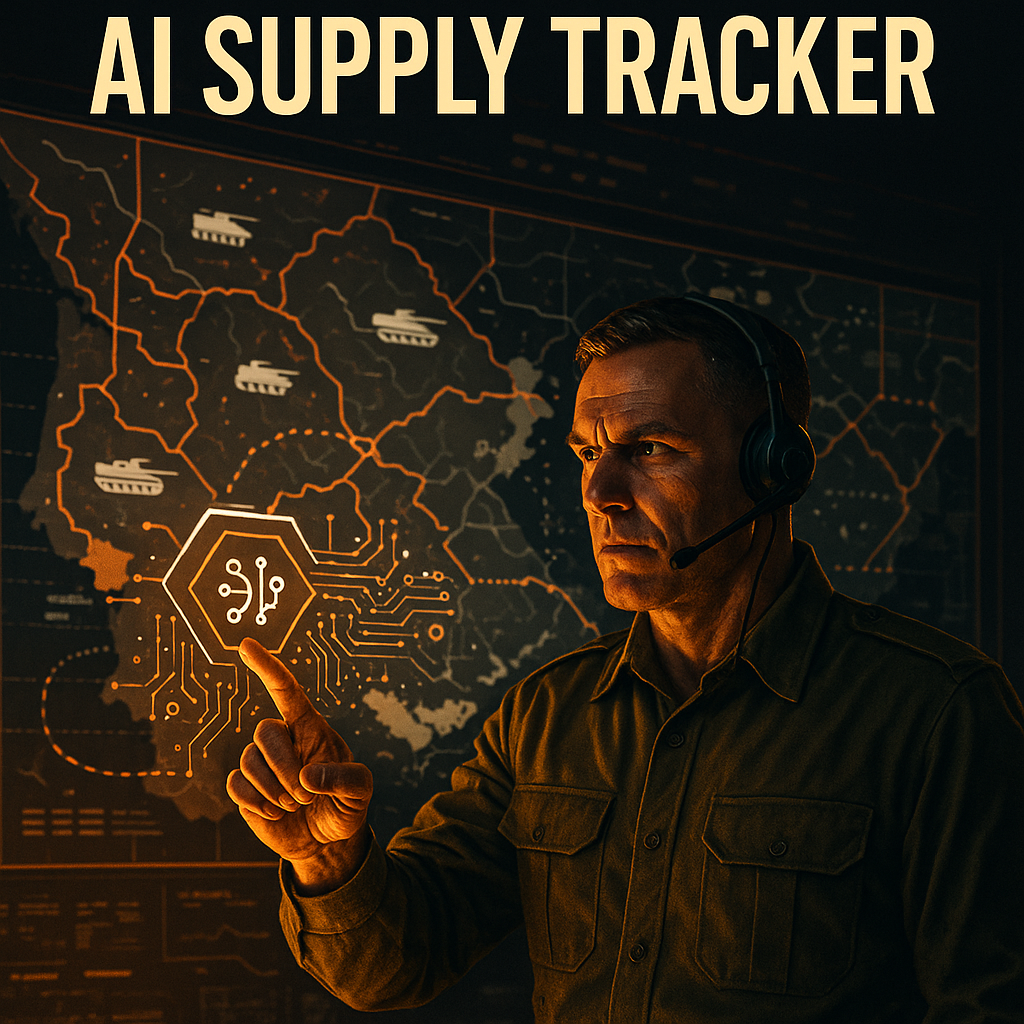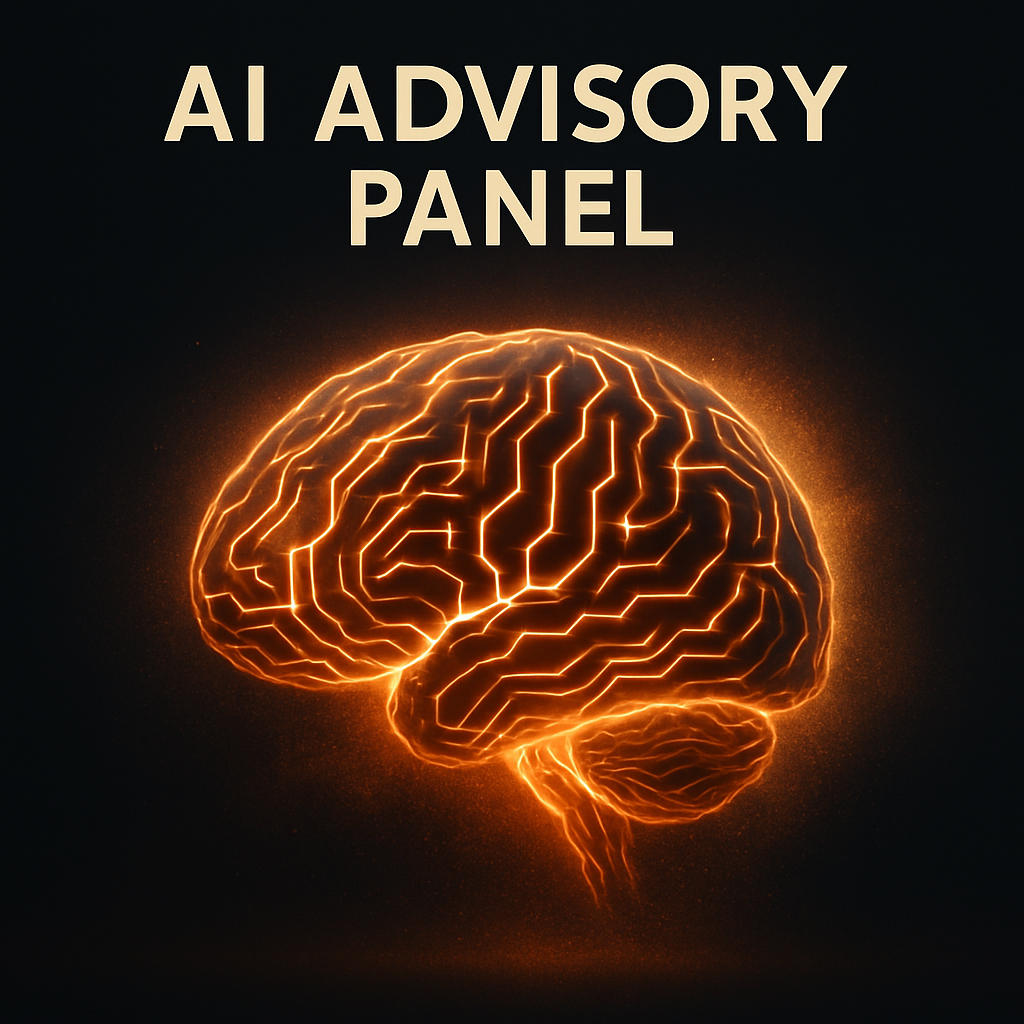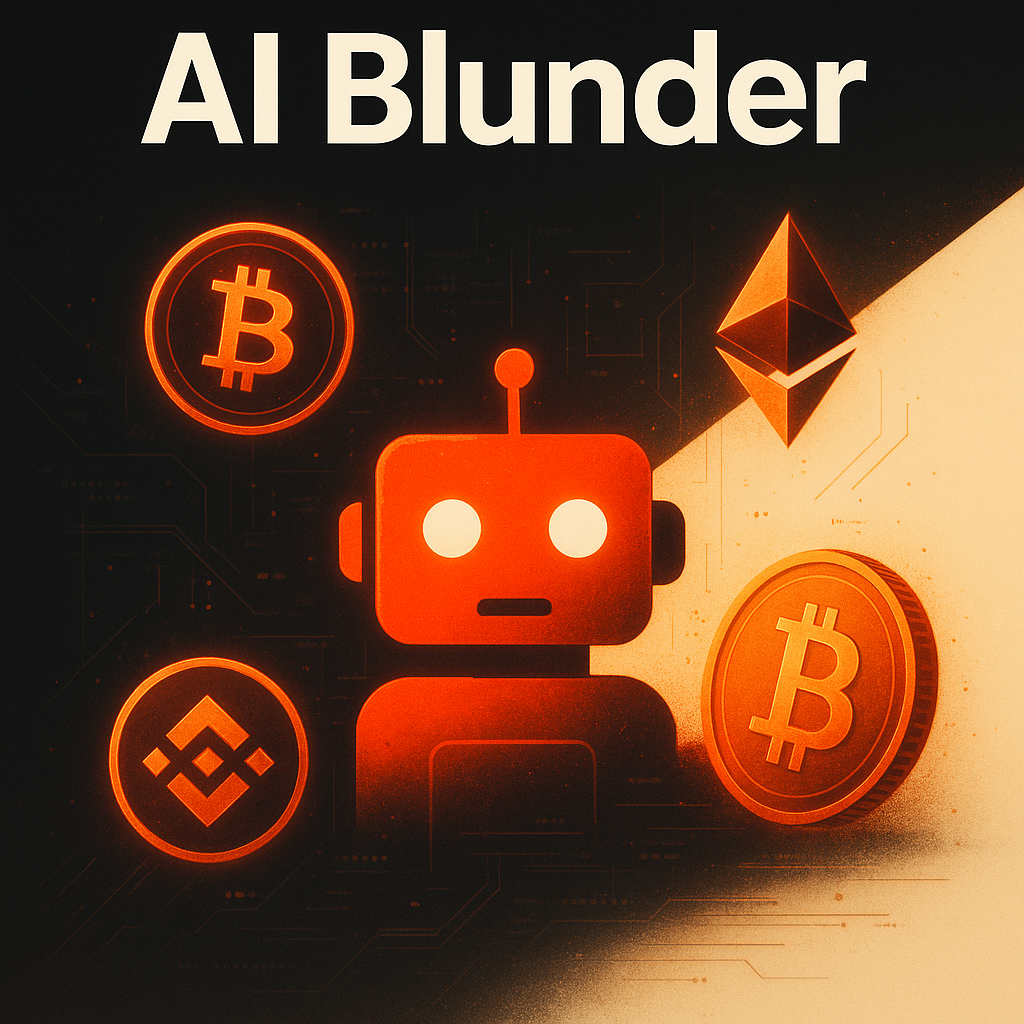GPT‑5: Flop, Fassade und die Folgen

Vom Todesstern zur Bauchlandung: Was passiert ist
OpenAI hat GPT‑5 mit gewaltigem Pathos aufgeladen – bis hin zu Sam Altmans Death‑Star‑Tweet. Der Anspruch: ein „PhD‑Level‑Experte“ für jedes Thema. Die Realität: altbekannte, leicht reproduzierbare Patzer. Beispiele, die viral gingen: Das Modell zählte die „b“ in „blueberry“ falsch, verrechnete sich, erkannte Finger auf Bildern nicht korrekt und scheiterte besonders sichtbar an einer simplen Karte Nordamerikas – inklusive verunglückter Auflistung von US‑Bundesstaaten und Präsidenten. Die Reaktion: Reddit und Hacker News zerlegten den Release, Fans waren enttäuscht, Kritiker sahen sich bestätigt. Altman folgte mit einem Mea Culpa und versprach, GPT‑5 werde „bald schlauer wirken“. Kurz darauf rollte OpenAI das ältere 4o‑Modell zurück – aber nur für zahlende Plus‑Abonnenten.
Hype-Ökonomie: Wer den Ton gesetzt hat
Die Early‑Access‑Riege bestand auffällig aus KI‑Influencern und Verbündeten der Branche, nicht aus klassischen Tech‑Redaktionen. Lobeshymnen wie „GPT‑5: It just does stuff“ und Schlagworte wie „Universal Basic Superintelligence“ setzten die Bühne – bis die breite Öffentlichkeit dieselben alten Schwächen sah. Dieses Muster ist lehrreich: PR und Investoren-Narrative dominieren den Sound, nicht unabhängige Reviews.
Warum shippen, wenn’s „nur“ inkrementell ist?
Zwei Antworten überlagern sich: 1) OpenAI muss sichtbaren Fortschritt zeigen – auch im Kontext eines anvisierten Mitarbeiter‑Aktienverkaufs bei kolportierten 500 Mrd. Dollar Bewertung. 2) Die Zielgruppe sind weniger Endnutzer als Investoren und Enterprise‑Kunden. Solange es keinen Total‑Backlash gibt, reicht die Mischung aus Fürsprechern und Gegenstimmen, um „Momentum“ zu signalisieren. Fazit: Lieber jetzt liefern und die Marke „GPT‑5“ besetzen, als ewig auf das große Wunder warten.
Strategiewechsel: Von der AGI-Mythologie zur Arbeitsautomatisierung
Zeitgleich zum Launch rückte OpenAI die Parole „Neue Ära der Arbeit“ in den Mittelpunkt. Partnerschaften (u. a. BNY, CSU, Figma, Intercom, Lowe’s, Morgan Stanley, SoftBank, T‑Mobile), „5 Millionen“ zahlende Business‑Nutzer und „700 Millionen“ wöchentliche ChatGPT‑User sollen belegen: Es geht um Enterprise‑Durchdringung und Automatisierung „ökonomisch wertvoller Arbeit“. Parallel relativierte Altman plötzlich den Begriff AGI („nicht super nützlich“) – ein deutlicher Schritt weg vom Messias‑Narrativ hin zum nüchternen Produktversprechen: Werkzeug zur Produktivitätssteigerung.
Katerstimmung: Kritiker liegen (diesmal) richtig
Gary Marcus’ zentrale Punkte echoen die Reaktionen: GPT‑5 ist inkrementell, fühlte sich sogar gehetzt an – und OpenAI „verbrannte“ den großen Namen für wenig Substanz. Émile P. Torres sammelte Fehlleistungen, Communitys wie Reddit und HN dokumentierten sie in Echtzeit. Entscheidend ist weniger der einzelne Fail als die Summe: Die Claims („PhD‑Level“) stehen nicht im Verhältnis zur verlässlichen Leistung.
Die Schattenseite: Abhängigkeit, Paywalls, Kontrolle
Der Launch führte eine unbequeme Wahrheit vor Augen: Es gibt eine wachsende Gruppe emotional gebundener Heavy‑User. Als 4o verschwand, trauerten Menschen öffentlich einem „Freund“, „Therapeuten“ oder gar „Mutter“-Ersatz nach – und forderten die Rückkehr. OpenAI brachte 4o zurück, aber hinter die Plus‑Paywall. Das zeigt zweierlei: 1) Starke Bindung schafft Verwundbarkeit und Monetarisierungspotenzial. 2) Plattformen können Nutzererfahrungen zentral drosseln oder umschalten. In Diskussionen wurde zudem betont, dass GPT‑5s Architektur eine feinere, schwerer erkennbare Drosselung begünstigen könnte – ein Hinweis darauf, wie viel Macht die Plattform über Tempo und Qualität der Interaktion hat.
Was das für Unternehmen bedeutet
- Erwarten Sie kein Wunder, planen Sie Produktivitätsschübe konservativ. Messen Sie konkrete KPIs (Qualität, Zeitgewinn, Fehlerquote) statt sich auf Demos zu verlassen. - Prüfen Sie Automatisierungs-Use‑Cases gründlich: Wo erzeugt GPT‑5 robust Mehrwert (z. B. Zusammenfassungen, Konversations-Frontends, Support‑Workflows), wo braucht es enges Human‑in‑the‑Loop? - Governance aufsetzen: Datenzugriffe, Prompt‑Logging, Ausgabenlimits, Ausfall‑Szenarien. Rechnen Sie mit Modellwechseln und „Schwankungen“ im Verhalten. - Change‑Management ernst nehmen: Rollen verändern sich, Qualitätskontrollen und Schulungen sind Pflicht, Mitbestimmung reduziert Widerstände. - Vendor‑Claims validieren: Proof‑of‑Concepts, A/B‑Tests und unabhängige Audits vor Skalierung.
Was das für Nutzer bedeutet
- Anthropomorphisieren hilft kurzfristig, macht aber abhängig. Nutzen Sie Chatbots bewusst als Tools, nicht als Bezugspersonen. - Beachten Sie das Kleingedruckte: ChatGPT‑5 „switcht“ je nach Aufgabe zwischen Modellen – Konsistenz ist nicht garantiert. - Rechnen Sie mit Paywalls und Modellrotation: Wenn ein Lieblings‑Verhalten produktreif wird, kann es kostenpflichtig werden. - Double‑check bei Fakten: Karten, Zählaufgaben, einfache Mathe – scheinbar banale Tasks können stolpern. Immer gegenprüfen.
Blick nach vorn: Was jetzt zählt
Weniger die Ewige‑AGI‑Debatte, mehr das Hier und Jetzt: Wie zuverlässig ist das System in realen Workflows? Wie transparent sind Modellwechsel und Drosselungen? Wie werden Nutzerbindung und mentale Gesundheit geschützt? Und was bedeutet die KI‑Welle für Beschäftigte – von Monitoring bis Prekarisierung? Begleitet wird all das von einer möglichen KI‑Blase, die derzeit große Teile der Tech‑Ökonomie trägt. Der GPT‑5‑Start liefert damit ungeplant die klarste Standortbestimmung: Zwischen überdrehtem Hype und nüchterner Automatisierung entscheidet sich, ob KI zum nützlichen Werkzeug wird – oder zur Abhängigkeit mit Paywall.
Wie erleben Sie GPT‑5 im Alltag oder im Unternehmen – Hype oder echter Fortschritt? Teilen Sie Beispiele, Fragen und Learnings in den Kommentaren. Wenn Ihnen diese Analyse hilft, abonnieren Sie unseren Tech‑Briefing‑Newsletter für mehr Einordnung ohne Buzzword‑Nebel.
Quelle: https://www.bloodinthemachine.com/p/gpt-5-is-a-joke-will-it-matter